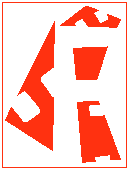
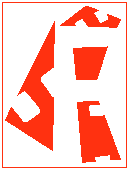
| Sonderberichterstattung |
| zum Internationen Filmwochenende in
Würzburg
vom 28.-31.1.1999 |
| Vier Entdeckungen habe ich gemacht beim Filmwochenende, unterschiedlichster Art, aber dafür hat sich der Besuch gelohnt. |
| Entdeckung Nummer Eins ist genau 25 Jahre alt und
war Wim Wenders' 'Alice in den Städten'. Die letzten Filme von Wenders, vor allem 'The End of Violence', fand ich katastrophal schlecht, Predigten, die lächerlich scheitern an den großen Thesen, die sie vor sich hertragen. Die Kluft zwischen Ernsthaftigkeit und Größe der These und dem peinlich geringen intellektuellen Aufwand, den Wenders (auch und erst recht im Bund mit Nicolas Klein) zu treiben in der Lage ist, frißt diese Filme, an denen das einzig dynamische die Flucht des Zuschauers aus dem Kino ist. |
| Nun gibt es in 'Alice in den Städten' durchaus
Szenen (aber ausschließlich im ersten, amerikanischen Teil), die von
der später überhandnehmenden Peinlichkeit sind, jener
prätentiöse Mischung von Tief- und Stumpfsinn, die den sogenannten
Neuen Deutschen Film sehr zur recht in Verruf gebracht hat. Schon hier hat
das mit Abbildung, Bildern, Film/Fotografie zu tun, schon hier zerstört
das den einen und anderen Dialog. Ist der Film aber erst einmal in Deutschland,
ist Rüdiger Vogler erst einmal mit der kleinen Alice im Ruhrgebiet
unterwegs, hat es erfreulicherweise ein Ende damit und die Bilder und Szenen
tun das, was Wenders' Worte nie konnten und niekönnen werden: sie verzaubern
einen. Und sie verzaubern Deutschland, genauer gesagt: das Ruhrgebiet. Die
Bilder sind von der schwarz-weißen Schönheit, die Szenen von jener
prägnanten Lakonik, die es erst beim frühen Jim Jarmusch wieder
geben wird. Wenders hat eine eigene Filmsprache, die weder dem Kitsch, der
der sich entwickelnden Freundschaft zwischen dem Mann und dem Mädchen
nahe liegen könnte, noch dem Grauen, das in vermeintlichem Sozialrealismus
droht, erliegt. Die Kamera erklärt hier nichts. Sie zeigt und schweigt.
Sie beobachtet und rückt nicht zu nahe. Es gibt eine wunderbare Szene
in einem Café, in der zwischen Rüdiger Vogler/Alice und einem
Jungen neben der Juke Box hin- und hergeschnitten wird. Nichts entwickelt
sich, die Spannung liegt allein im Schnitt, der Einsamkeit des Jungen, die
vermittelt wird. Es gibt hier keine narrative Finalität, die Geschichten
wollen in ihren besten Momenten auf nichts hinaus. Der Zuschauer ist Zeuge
eines glücklichen filmischen Nebenbei, das doch alles ist, was man wollen kann. Hätte Wenders doch nie angefangen, in Worten zu denken. |
| Entdeckung Nummer Zwei war Phillip Noyce, der australische Regisseur, der persönlich anwesend war. 'Dead Calm' hat sich beim zweiten Sehen erst recht als Meisterwerk erwiesen. Noyce ist der rare Vogel eines intelligenten Hollywood-Regisseurs. Jede seiner Einstellungen wirkt wohl bedacht. Das einzige, was man 'Dead Calm' vorwerfen kann, ist, daß er vielleicht zu perfekt ist. Es gibt in diesem Film keine Redundanz: alles, was sich ereignen wird, ist unaufdringlich, aber pointiert vorbereitet. Was Noyce der Romanvorlage hinzuerfunden hat, das Trauma Nicole Kidmans, deren Kind bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, den sie gerade so überlebt, ist von der Geschichte gar nicht wegzudenken: das schiere Böse, das Billy Zane verkörpert, ist das untote Kind, das endgültig und noch einmal (und mehr als einmal) getötet werden muß, damit die Eheleute wieder ihren Frieden finden. Die Topographie der beiden Boote ist - wiederum unaufdringlich - auf Psychoanalytisches hin lesbar und zugleich Teil eines brillant ausgetüftelten Spannungsmechanismus. |
| Noyces früher australischer Film 'Heatwave' ist ein seltsamer Zwitter. Die arg konventionelle und vorhersehbare Story (wahren Begebenheiten folgend) verträgt sich überhaupt nicht mit dem Stil, den Noyce hier entwickelt hat. Es ist, als wisse Noyce noch nicht, daß er das Gegenteil eines Dokumentaristen ist, nämlich der Meister einer eigenen suggestiven und vor allem völlig artifiziellen Filmsprache, aus der sich am Ende niemals Realitätseffekte herausdestillieren lassen. 'Heatwave' ist bereits (und mehr als alle späteren Filme) reiner Stil, reine Klaustrophobie im Zusammenspiel von Kamera (mit deutlichen Farbfiltern), symbolischem, nicht narrativem Schnitt und kommentierendem, nicht untermalendem und dennoch suggestivem Musikeinsatz. Leider wird die Story vondieser Kunstfertigkeit erdrückt, Peter Weir hat in seinem durchaus vergleichbaren 'Ein Jahr in der Hölle' eine ausgewogenere Mischung gefunden. Dennoch wird bereits an diesem Film deutlich, warum Noyce einer der großen Könner im Hollywood-Kino geworden ist. Noch dazu, das sei kurz angefügt, hat er sich in den Diskussionen zu den Filmen als überaus gewinnende, intelligente, witzige und souveräne Persönlichkeit erwiesen. |
| Entdeckung Nummer Drei war Noemie Lvovskys 'Petites'
von 1997, der unter dem Titel 'Verrückt nach Liebe' bereits im deutschen Fernsehen gelaufen ist. 'Oublie Moi', Lvovskys Erstling, war ein quälendes und begeisterndes Meisterwerk. 'Clubbed to Death', bei dem sie am Drehbuch mitgearbeitet hat, war fast ebenso gut. Nach diesem Film ist endgültig klar, daß Lvovsky die interessanteste französische Regisseurin ihrer Generation ist. Der Ton ist hier eher burlesk als tragisch - und doch ist eines der Wunder des Films, daß es neben den herzzereißend komischen Szenen um vier pubertierende Mädchen immer wieder Momente des Entsetzens, der Hereinbrechens von Tod, Qual, Sadismus gibt. Das Komische und das Entsetzliche stehen unvermittelt nebeneinander, aneinandergeschnitten untrennbar wie zwei Seiten einer Medaille. Nichts gleicht sich dabei aus, das eine erklärt nicht das andere. Beides ist da, von einem Moment zum anderen springt der Ton um - und es ist genau richtig so. Nicht alles überzeugt voll und ganz - Valeria Bruni-Tedeschis Rolle als eingebildete drohende Mutter eines der Mädchen scheint ein wenig zu dick aufgetragen - aber es gehört zum Zauber des Films, daß man ihm alles verzeiht, was auf der Waage des Kunstverstands zu Bedenken Anlaß geben könnte. |
| Die letzte Entdeckung war Robert Flahertys 'Louisiana
Story' von 1948, der in einer neu rekonstruierten Fassung zu sehen war. Flaherty ist einer der großen frühen Meister des Dokumentarfilms. In 'Louisiana Story' verbindet er die dokumentarischen Aufnahmen von den Sümpfen und der Ölgesellschaft, die dort Probebohrungen vornimmt, mit einer simplen Geschichte um einen Jungen und dessen Familie. Eigentlich funktioniert das überhaupt nicht, diese Verbindung, aber es ist derart ungelenk in Szene gesetzt, daß es bereits wieder seinen eigenen Charme hat. Das offensichtliche Ziel des Films ist Poesie in Bildern und Tönen - und über weite Strecken erreicht er es auch. Verblüffend daran ist, daß in diese allumfassende Poesie das Ölbohrunternehmen einfach eingebunden werden kann. Keine Spur von Kritik an diesem Eindringen von Kommerz und Technik in die friedvolle Natur - im Gegenteil: die Kamera und der symphonische Score leisten Poetisierungsarbeit an der Natur auf dieselbe Weise wie an der Technik. Ungewohnt ist das eben für letztere und nicht für erstere, aber so wird das Anstrengungsmoment der Kunst erst eigentlich deutlich: Natur ist nicht als poetische vorfindlich wie naive romantische Lesarten (bzw. naive Lesarten von Romantik) immer schon suggerieren. Diese Homogenisierung setzt sich fort in den hin und wieder aufblitzenden Momenten von Dramatik: im Kampf des Jungen gegen einen Alli- gator, der seine Parallele im Kampf der Männer gegen die Technik hat. Eine merkwürdig hergestellte Archaik auf beiden Seiten, die der Film nicht selbst reflektiert, aber in diesem Ineinander reflektierbar macht. Geradezu emblematisch das Schlußbild: der Junge, sein Waschbär und das aus dem Wasser ragende Rohr der Ölpipeline harmonisch vereint. |